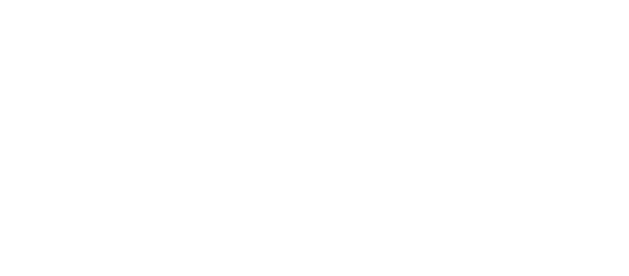Etymologie des Wortes Pálinka
Laut dem Erklärenden Wörterbuch der rumänischen Sprache ist pálinka „ein destilliertes alkoholisches Getränk aus Früchten, auch horincă genannt“, das durch alkoholische Gärung und Destillation von fleischigen Früchten oder einer Mischung aus Früchten, Maische oder Fruchtsaft hergestellt wird, mit oder ohne Kerne.
Das Substantiv pálinka stammt aus dem österreichisch-ungarischen Raum und leitet sich vom slawischen Verb paliti (slowakisch: páliť, tschechisch: palit, polnisch: palić) ab, was „brennen, destillieren“ bedeutet. Es findet sich in verschiedenen Formen – von Slowenien und Ungarn bis nach Österreich, Polen und in die Slowakei – als palenka oder paljenka.
Die Zisterziensermönche führten im 14. Jahrhundert, insbesondere in den sächsischen Städten Siebenbürgens, die aus Früchten destillierten Spirituosen ein. Diese wurden nach dem deutschen Branntwein als vinars bezeichnet, folgten der mittelalterlichen Tradition des aqua vitae und wurden fast ausschließlich zu medizinischen Zwecken verwendet.
In bestimmten Gegenden Nordwest-Rumäniens, wo diese Praxis verbreitet war, hielt sich lange der Begriff ocovit oder ocovită, der sich vom lateinischen aqua vitae über die polnische (okowita) und ukrainische (okovitka) Form entwickelte. In der rumänischen Sprache gibt es zahlreiche Bezeichnungen für hochprozentige Getränke.
Ob als țuică, pálinka, horincă, rachiu, vinars, trascău, comină, tescovină, secărică oder crampă muierească – über die Landesgrenzen hinaus bleibt der Hochprozentige eine Visitenkarte, eine wertvolle Währung und ein Heilmittel, wenn er in Maßen genossen wird.
Herkunft und Geschichte
1. Destillation
Die Destillation ist ein Verfahren zur Trennung der Bestandteile einer Flüssigkeit durch Erhitzen und anschließendes Kondensieren der entstehenden Dämpfe. Bei Spirituosen wird der Alkoholgehalt durch Destillation aus der Grundmasse – die Bier, Wein, fermentierte Maische aus Getreide, Früchten oder Pflanzen sein kann – extrahiert.
Während des Destillationsprozesses werden die Grundstoffe erhitzt, und die aufgrund der unterschiedlichen Siedepunkte freigesetzten Gase werden in ein spezielles System geleitet, in dem sie gekühlt und kondensiert werden. Die resultierende Flüssigkeit wird als Destillat oder alkoholischer Tartrat bezeichnet.
2. Die Destillieranlage (Alambic)
Die Destillation mit einer Destillieranlage – Alambic – hat ihren Ursprung im Arabischen (الأنبيق – Al-inbiq). Es handelt sich um eine uralte Technik, die bereits 3000 v. Chr. in China angewendet wurde und später von den Indern, Ägyptern, Griechen und Römern übernommen wurde. Die von diesen Völkern hergestellte Flüssigkeit wurde später von den Arabern Alkohol genannt und sowohl zu medizinischen Zwecken als auch zur Herstellung von Parfums verwendet.
Das Wort Alkohol stammt vom arabischen al-kuḥl, was ursprünglich eine feine Pulverform von Antimonit für die Augen bedeutete. Die Destillieranlage besteht aus drei Hauptteilen: einem Behälter, einem Kühler und einem Verbindungsschlauch.
Im 6. Jahrhundert brachten die Araber mit ihren Eroberungen in Europa auch die Destillationstechnik mit. Europäische Alchemisten und Mönche verbesserten die Methode und die Destillationsgeräte.
3. Die Entwicklung der Destillation
a) Die Antike
Schon in der Antike versuchten die Menschen, durch Destillation aus fermentierten Früchten und Pflanzen Getränke zu gewinnen. Im Laufe der Zeit verbreiteten sich diese primitiven Methoden weltweit.
Die älteste schriftliche Erwähnung der Destillation von Wein wird dem griechischen Philosophen Anaxilaos zugeschrieben, der 28 v. Chr. aus Rom verbannt wurde, da man ihm magische Praktiken vorwarf.
Im 6. Jahrhundert nutzten persische Ärzte in der medizinischen Schule von Jundishapur (heute Iran) die Destillation zur Herstellung medizinischer Elixiere.
b) Das Mittelalter
Im Mittelalter nutzten Wissenschaftler, insbesondere Alchemisten, die Destillation in großem Umfang. Die durch diesen Prozess gewonnenen Essenzen wurden als das fünfte Element bezeichnet. Der früheste bekannte Name für Spirituosen war aqua ardens („brennendes Wasser“ oder „brennender Destillat“). Medizinische Kräuterextrakte, die durch mehrere Destillationsprozesse gewonnen wurden, hießen aqua vitae („Wasser des Lebens“).
Im 15. Jahrhundert, als sich die Kunst der Destillation in Irland und Schottland verbreitete, wurde aqua vitae allmählich zu uisge beatha, dem heutigen Whisky.
Die älteste detaillierte Beschreibung der Destillation stammt aus dem 12. Jahrhundert aus Italien, von der Universität Salerno.
Die in Italien beschriebene Methode der Wein-Destillation verbreitete sich bereits im 12. Jahrhundert nach Ungarn. Die Ehefrau von König Karl I. (Károly Róbert), Königin Elisabeth (1305–1380), verwendete mit Rosmarin aromatisierten Weinbrand zur Behandlung ihrer Gicht. Dieses Elixier wurde als Aqua Hungarica, Aqua Reginae Hungarinae oder Eau de la Reine d’Hongrie bekannt.
c) Das 19. Jahrhundert
Der Franzose Jean-Baptiste Cellier Blumenthal patentierte 1813 die ersten Kolonnen-Destillationssysteme. Diese waren effizienter als die zuvor verwendeten Kessel und ermöglichten eine sauberere und hochprozentigere Spirituosenproduktion mit weniger Brennstoffverbrauch.
Der französisch-irische Erfinder Aeneas Coffey verbesserte dieses System erheblich und patentierte 1830 seine erste Anlage zur Raffinierung von Getreidealkohol. Er gilt als Erfinder der modernen Destillationstechnologie, die noch heute verwendet wird.
Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts hatten sich Kupfer-verkleidete Destillationssysteme mit Wasserkühlspiralen weltweit verbreitet.
Die erste dokumentarische Erwähnung
Im Jahr 1459 kritisierte König Matthias in lateinischen Aufzeichnungen die Bevölkerung Südslowakiens, die während einer Hungersnot weiterhin „durch Verbrennen Wein aus Getreide herstellte“.
Die erste Erwähnung des Wortes pálinka stammt aus dem Jahr 1572, als noch die Bezeichnung balenka verwendet wurde, die vom slowakischen oalenka stammt.
Für viele Jahre wurde der Begriff vinars hauptsächlich für aus Getreide und später aus Früchten hergestellte Getränke verwendet. Die erste Erwähnung von gebranntem Wein auf Ungarisch findet sich in einem 1438 datierten Kassenbuch von Bardejov (Slowakei).
Die älteste bekannte Erwähnung einer Destillationsanlage auf rumänischem Gebiet stammt aus dem Jahr 1332. Die erste schriftlich erwähnte und weit verbreitete Spirituose war vinars, das in der moldawischen Chronik erwähnt wird.
In Westsiebenbürgen finden sich in mehreren mittelalterlichen Aufzeichnungen Hinweise auf Pflaumenplantagen und Pálinka-Destillen. Ein 1773 erstelltes Verzeichnis aus Südbihor dokumentiert Brennereien in fast jedem Dorf.
In 1784 errichtete der Staat in Siebenbürgen steuerpflichtige Schankhäuser und führte Alkohol- und Weinsteuern ein.
Pálinka war und bleibt ein zentrales Element der siebenbürgischen und slowakischen Kultur – eine wahre Dorflegende.
Edward und der Puszta-Cocktail
Im Jahr 1935 war der Prinz von Wales (Prince of Wales), der später gezwungen war, auf den Thron zu verzichten, Gast im Ritz Hotel in Budapest.
Die legendäre Figur der Gastfreundschaft des 20. Jahrhunderts, Papp Endre, erinnert sich in seinem Buch „A vendéglős és híres vendégei” („Der Wirt und seine berühmten Gäste“) an den Besuch von Prinz Eduard und erzählt eine amüsante Anekdote. Während seines Aufenthalts im Hotel verlangte der Prinz einen ungarischen Cocktail. Da ein solcher Cocktail nicht existierte, löste der Hotelmanager Marentsics Otto die unangenehme Situation elegant und servierte dem Gast ein Getränk, das ausschließlich aus ungarischen Zutaten bestand: Aprikosenpálinka, Mecseki-Likör und trockener Tokajer Zamorodni.
Begeistert vom Geschmack bestellte Prinz Eduard noch ein Glas und fragte, wie das Getränk heiße…
So wurde der Puszta-Cocktail erfunden!
Palinka Slavia
Tradition seit 1811 – Die Geschichte begann hier in Huta, in Șinteu, wo vor über 200 Jahren die ersten slowakischen Siedler ankamen, um Glas zu produzieren und in den Wäldern zu arbeiten. Sie ließen wilde Kirschbäume in den Wäldern von Șinteu zurück, und so begann die Produktion des ersten Wildkirsch-Pálinka.
Diese hochprozentige Energiequelle wurde hauptsächlich von Männern getrunken – für die harte Arbeit im Wald, auf den Feldern, beim Mähen, um schwierige Zeiten besser zu überstehen, aber auch in glücklichen Momenten mit der Familie, an Feiertagen, bei Hochzeiten, Taufen oder Beerdigungen.
Palinka Slavia – der Name stammt aus dem Slowakischen: palenka bedeutet „brennen“ oder „destillieren“. Slavia steht sowohl für „Feier“ als auch für den Familiennamen Miroslav Iabloncsik.
Die Palinka Slavia wird aus wilden Früchten hergestellt: Kirschen, Äpfeln, Birnen, Pflaumen, Brombeeren, Himbeeren und Heidelbeeren. Diese Früchte werden niemals behandelt oder gespritzt und sind daher 100 % ökologisch. In besonders guten Jahren reift ein Teil der Produktion in neuen Eichenfässern, wodurch ein einzigartiges, intensiveres Aroma entsteht. Die Stärke des Pálinka wird anhand der Perlen bestimmt, die sich nach dem Schwenken des Glases bilden und etwa 60 Sekunden lang bestehen bleiben sollten.
Die Slowaken aus dem Dorf produzieren außerdem Secărica, einen Roggenbrand, der heute als Rohstoff für Whisky und Borovička verwendet wird. Secărica ist ein Destillat aus Roggen und Wacholderbeeren (kleine, pfefferkornähnliche Beeren). Nach einer zwei- bis dreijährigen Mazeration entsteht ein edles, feines und hochwertiges Produkt.
Der fruchtbare Boden und die Hingabe der Dorfbewohner machen diesen Pálinka einzigartig und zu einem der begehrtesten in „Klein-Slowakei“ und im ganzen Land. Die Glasflaschen, in denen der Pálinka abgefüllt wird, werden lokal hergestellt und direkt in der benachbarten Glaswerkstatt gebrannt.
In Huta stand, steht und wird der Pálinka immer im Mittelpunkt stehen – er ist ein Symbol der slowakischen Kultur in Șinteu.
Egal ob Genießer oder Gelegenheitstrinker – Palinka Slavia gilt hier als Heilmittel. In Huta bleiben die Türen offen, und in jedem slowakischen Haushalt steht immer eine Flasche mit Gläsern für Gäste bereit. Wenn ein Slowake seinen Nachbarn über den Hügel besucht und ihn nicht zu Hause antrifft, bedient er sich mit einem Glas Pálinka und geht weiter – und vergisst schnell, dass sein Nachbar nicht da war.
Wann immer die Dorfbewohner mit ihren Wagen in den Wald, zur Arbeit oder zum Markt fahren, nehmen sie eine Flasche Pálinka mit – so lernen sie neue Menschen kennen und schließen langanhaltende Freundschaften.
Es gibt auch die Tradition, dass Männer aus demselben Glas trinken – um eine Vereinbarung, einen Handel oder ein Bündnis zu besiegeln.
Ein lebendiges Freilichtmuseum
Touristen, die Șinteu besuchen, können die gesamte Geschichte des Dorfes an einem einzigen Ort entdecken – in einem Freilichtmuseum (Skanzen) auf 22 Hektar mit einem 3 km langen Rundweg. Hier wird jeder Reisende mit Gastfreundschaft und traditioneller Küche empfangen. Und der Pálinka ist der wahre Schatz des slowakischen Dorfes Șinteu!
Als ein Wendepunkt in der Geschichte der Slowaken aus Șinteu wird die Huta-Geschichte mit der Palinka Slavia und dem Pálinkahaus (Palenica) weitergeschrieben. Dank traditioneller, aber auch modernerer Destillationstechniken kann der Besucher genau erfahren, wie Pálinka hergestellt wird, welche Zutaten verwendet werden und welche Rolle dieses Getränk in der Geschichte Siebenbürgens spielt.
In dieser kleinen handgemachten Destillerie wird mit Leidenschaft und Hingabe gearbeitet. Jeder Tropfen, der aus dem Brennkessel fließt, ist ein Stück Geschichte der Slowaken, die vor über 200 Jahren an diesen gesegneten Ort kamen, den sie Nova Huta nannten.
Um den einzigartigen Geschmack und das ursprüngliche Aroma der Früchte, aus denen Palinka Slavia hergestellt wird, voll zu genießen, wird empfohlen, ihn maßvoll bei einer Temperatur von 16–18°C zu servieren.
NA ZDRAVIE!











Our Brands